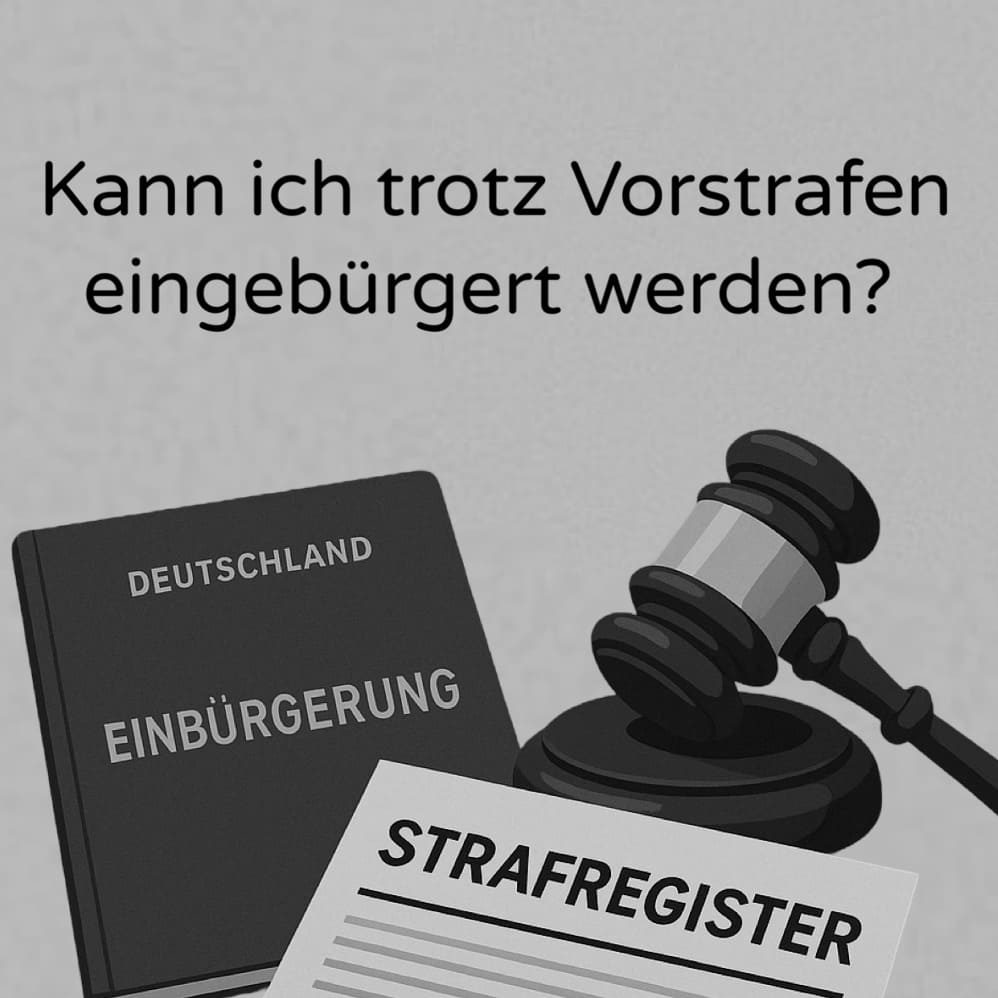Immer wieder kommt es in meiner Praxis zu der Frage, ob trotz Vorstrafen eine Einbürgerung möglich ist. Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 StAG ist die Einbürgerung grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die betroffene Person wegen einer Straftat verurteilt wurde oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung gegen sie angeordnet ist.
Damit steht fest: Eine strafrechtliche Verurteilung ist im Regelfall ein Einbürgerungshindernis.
Häufige Missverständnisse bei der Einbürgerung trotz Vorstrafe
Viele Betroffene gehen davon aus, eine Geldstrafe – insbesondere, wenn sie im Strafbefehlsverfahren verhängt und bereits bezahlt wurde – sei „erledigt“ und habe keine weiteren Folgen. Ebenso bei Bewährungsstrafen, die sich erledigt haben. Es bleibt aber auch nach Erledigung eine Vorstrafe, die im Bundeszentralregister eingetragen bleibt und im Einbürgerungsverfahren berücksichtigt werden muss. Anders als im Aufenthaltsrecht kommt es nicht darauf an, ob ein Lebenswandel stattgefunden hat oder keine erneute Straffälligkeit zu erwarten ist.
Wann Vorstrafen bei der Einbürgerung unbeachtlich sind
Das Staatsangehörigkeitsgesetz kennt bestimmte Fallgruppen, in denen eine Verurteilung außer Betracht bleibt:
- Geldstrafen bis zu 90 Tagessätzen
- Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten (nur unbeachtlich, wenn sie von Beginn an zur Bewährung ausgesetzt wurden und sich die Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit erledigt hat)
- Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Keine Ausnahme bei Jugendstrafe: Sie steht der Einbürgerung stets entgegen, da ihr gesetzliches Mindestmaß sechs Monate beträgt – auch dann, wenn das Strafmakel nach § 100 JGG später beseitigt wurde.
Auch ausländische Verurteilungen werden berücksichtigt, wenn die Tat im Inland als strafbar anzusehen ist, das Verfahren rechtsstaatlich geführt wurde und das Strafmaß verhältnismäßig ist.
Darüber hinaus können Maßregeln der Besserung und Sicherung die Einbürgerung verhindern. Lediglich in engen Ausnahmefällen – etwa bei einer Entziehung der Fahrerlaubnis oder einem Berufsverbot – kann eine andere Bewertung erfolgen.
Bei mehreren Verurteilungen zu Geld- oder Freiheitsstrafen sind diese zusammenzurechnen, es sei denn, es wurde eine niedrigere Gesamtstrafe gebildet. Übersteigt die Strafe oder die Summe der Strafen die Grenze nur geringfügig, entscheidet die Behörde im Einzelfall, ob sie trotzdem außer Betracht bleiben können.
Das bedeutet aber, auch mehrere kleine Geldstrafen können zu einem Ausschluss führen.
Keine Ausnahmen gibt es bei Hasskriminalität: Wer wegen Taten verurteilt wurde, die aus antisemitischen, rassistischen oder sonst menschenverachtenden Beweggründen begangen wurden, ist von der Einbürgerung zwingend ausgeschlossen (§ 46 Abs. 2 StGB i.V.m. § 10 StAG).
Härtefälle: Einbürgerung trotz Vorstrafe nur in Ausnahmefällen
Wird die Erheblichkeitsschwelle überschritten, gibt es noch die Ausnahme eines Härtefalls (§ 8 Abs. 2 StAG). Die Anforderungen sind jedoch extrem hoch: Es müssen atypische, besonders belastende Umstände vorliegen. In der Praxis kommt das nur selten vor – bleibt aber rechtlich eine Möglichkeit.
Tilgungsfristen im Bundeszentralregister und ihre Bedeutung für die Einbürgerung
Wenn durch eine Vorstrafe die Einbürgerung ausgeschlossen ist, bedeutet das nicht automatisch ein dauerhaftes Hindernis. Maßgeblich ist, wann die Vorstrafe nach dem Bundeszentralregistergesetz (BZRG) getilgt wird. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Zeitpunkt, zu dem die Strafe selbst erledigt ist (z. B. Zahlung der Geldstrafe oder Ablauf der Bewährung).
Die Tilgungsfristen sind:
- Geldstrafen und kurze Freiheitsstrafen: in der Regel nach fünf Jahren
- Schwerere Strafen: nach zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren
Erst nach Tilgung darf eine Verurteilung im Einbürgerungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden (§ 51 BZRG).
Achtung: Neue Verurteilungen verzögern die Tilgung alter Eintragungen (§ 47 Abs. 3 BZRG). Das bedeutet: Selbst Verurteilungen, die für sich genommen nicht erheblich wären, können verhindern, dass ältere Strafen gelöscht werden – die Einbürgerung bleibt dadurch ausgeschlossen.
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit der vorzeitigen Tilgung nach § 49 BZRG. Diese wird aber nur in seltenen Ausnahmefällen gewährt. Die Rechtsprechung verlangt außergewöhnliche Umstände, die eine Fortdauer der Eintragung zu einer unbilligen Härte machen.
Solche Härten liegen etwa dann vor, wenn das ursprüngliche Urteil offensichtlich rechtsfehlerhaft war und dies ohne vertiefte Prüfung erkennbar ist. Allerdings dient § 49 BZRG nicht der nachträglichen inhaltlichen Überprüfung eines rechtskräftigen Urteils. Reine berufliche Nachteile oder Probleme bei Aufenthaltserlaubnis und Einbürgerung reichen nicht aus.
Vorstrafen und Ermittlungsverfahren im Einbürgerungsverfahren
Nicht nur Verurteilungen, sondern auch laufende Ermittlungsverfahren sind für die Einbürgerung relevant und müssen immer angegeben werden.
Das bedeutet: Selbst wenn nach Antragstellung ein Ermittlungsverfahren beginnt, muss die Behörde aktiv informiert werden. Auch bereits erledigte Verurteilungen (z. B. Geldstrafe bezahlt, Bewährung abgelaufen) gelten als Vorstrafen und sind anzugeben.
Offenlegungspflicht:
- Bereits bestehende Vorstrafen sind stets mitzuteilen.
- Auch laufende Ermittlungsverfahren sind relevant – selbst wenn sie erst nach Abgabe des Antrags beginnen.
- Die Mitteilungspflicht gilt bis zur Entscheidung über den Antrag.
Warum ist das so wichtig?
Wer etwas verschweigt, riskiert:
- die Ablehnung oder spätere Rücknahme der Einbürgerung,
- und zusätzlich eine Strafbarkeit wegen unrichtiger Angaben (§ 42 StAG Abs. 1: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).
Fazit: Einbürgerung trotz Vorstrafe ist möglich, aber nur in Ausnahmefällen
Eine Vorstrafe bedeutet jedoch nicht automatisch, dass eine Einbürgerung auf Dauer ausgeschlossen ist. Entscheidend sind die Art der Verurteilung, mögliche gesetzliche Ausnahmen und die Tilgungsfristen im Bundeszentralregister. Besonders wichtig ist die vollständige und ehrliche Offenlegung aller Vorstrafen und laufenden Ermittlungsverfahren – auch während des laufenden Einbürgerungsverfahrens. Es ist also entscheidend, frühzeitig bei Bedarf eine qualifizierte Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen – und zwar nicht erst im Einbürgerungsverfahren, sondern bereits zu Beginn eines Ermittlungsverfahrens. Ein Strafverteidiger, der zugleich die migrationsrechtlichen Folgen im Blick hat, kann hier für die Zukunft entscheidend sein.